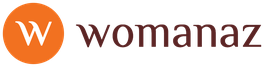Personifizierung der Flussbeispiele. Personifizierung ist die Kunst, das Unbelebte zum Leben zu erwecken. Die Geschichte des Auftretens der Personifikation
PERSONALISIERUNG
[oder Personifikation] – ein Ausdruck, der eine Vorstellung von einem Konzept oder Phänomen vermittelt, indem er es in Form einer lebenden Person darstellt, die mit den Eigenschaften dieses Konzepts ausgestattet ist (z. B. die griechische und römische Darstellung von Glück im Form einer launischen Glücksgöttin usw.). Sehr oft wird O. bei der Darstellung der Natur verwendet, die mit bestimmten menschlichen Eigenschaften ausgestattet ist, „animiert“, zum Beispiel: „Das Meer lachte“ (Gorki) oder die Beschreibung der Flut in Puschkins „Der eherne Reiter“: „...Newa die ganze Nacht / stürmten sie gegen den Sturm zum Meer, / sie hatten ihre gewalttätige Torheit nicht überwunden ... / und stritten
284 es wurde ihr unmöglich... / Das Wetter wurde wilder, / die Newa schwoll an und tobte... / und plötzlich, wie ein rasendes Tier, / stürmte sie auf die Stadt zu... / Belagerung! Attacke! böse Wellen, / wie Diebe, klettern durch die Fenster“ usw. O. war vor allem in der Präzisions- und falschklassischen Poesie im Einsatz, wo er konsequent und umfangreich ausgeführt wurde; In der russischen Literatur wurden Beispiele für solche O. von Tredyakovsky angeführt: „Reiten zur Insel der Liebe“, [SPB], 1730. O. ist daher im Wesentlichen eine Übertragung von Zeichen der Animation auf den Begriff oder das Phänomen und wird dargestellt als solche. arr. Art der Metapher (siehe). Siehe „Wanderwege“. L.T.
Literarische Enzyklopädie. 2012
Siehe auch Interpretationen, Synonyme, Bedeutungen des Wortes und was PERSONIFIKATION auf Russisch in Wörterbüchern, Enzyklopädien und Nachschlagewerken ist:
- PERSONALISIERUNG im Wörterbuch der literarischen Begriffe:
- Tropetyp: Darstellung unbelebter Objekte, in denen sie mit den Eigenschaften von Lebewesen ausgestattet sind (die Gabe der Sprache, die Fähigkeit zu denken, zu fühlen, zu erleben, zu handeln), ... - PERSONALISIERUNG im großen enzyklopädischen Wörterbuch:
(Prosopopoeia) eine Art Metapher, die die Eigenschaften belebter Objekte auf unbelebte überträgt („Ihre Amme ist die Stille …“, A. A. ... - PERSONALISIERUNG in der Großen Sowjetischen Enzyklopädie, TSB:
Prosopopoeia (vom griechischen prosopon – Gesicht und poieo – ich tue), Personifikation (vom lateinischen persona – Gesicht, Persönlichkeit und facio – ... - PERSONALISIERUNG im Enzyklopädischen Wörterbuch:
, -ich, Mi. 1. siehe personifizieren. 2. was. Über ein Lebewesen: die Verkörperung einiger. Merkmale, Eigenschaften. Plyushkin - o. Geiz. UM. … - PERSONALISIERUNG im Großen Russischen Enzyklopädischen Wörterbuch:
PERSONIFIKATION (Prosopopoeia), eine Art Metapher, die die Eigenschaften belebter Objekte auf unbelebte überträgt („Ihre Amme ist die Stille …“, A.A. ... - PERSONALISIERUNG im vollständigen akzentuierten Paradigma nach Zaliznyak:
Personifizierung, Personifizierung, Personifizierung, Personifizierung, Personifizierung, Personifizierung, Personifizierung, Personifizierung, Personifizierung, Personifizierung, Personifizierung, ... - PERSONALISIERUNG im Wörterbuch der Sprachbegriffe:
(Griechisch prosopopoieia, von prosopon – Gesicht + poieo – tun). Ein Tropus, der darin besteht, unbelebten Objekten Zeichen und Eigenschaften zuzuschreiben ... - PERSONALISIERUNG im Thesaurus des russischen Wirtschaftsvokabulars:
- PERSONALISIERUNG im russischen Sprachthesaurus:
„Ausdruck jeglicher abstrakter Qualitäten in einem bestimmten Objekt“ Syn: ... - PERSONALISIERUNG im russischen Synonymwörterbuch:
Ausdruck jeglicher abstrakter Qualitäten in einem bestimmten Objekt Syn: ... - PERSONALISIERUNG im neuen erklärenden Wörterbuch der russischen Sprache von Efremova:
Heiraten 1) Der Handlungsprozess nach Bedeutung. Verb: personifizieren, personifizieren. 2) a) Die Verkörperung von jdm. Urgewalt, Naturphänomene in Form von Lebewesen... - PERSONALISIERUNG in Lopatins Wörterbuch der russischen Sprache:
Personifikation... - PERSONALISIERUNG im vollständigen Rechtschreibwörterbuch der russischen Sprache:
Personifikation... - PERSONALISIERUNG im Rechtschreibwörterbuch:
Personifikation... - PERSONALISIERUNG in Ozhegovs Wörterbuch der russischen Sprache:
<= олицетворить олицетворение (о живом существе) воплощение каких-нибудь черт свойств Плюшкин - о. скупости. О. … - PERSONALISIERUNG im Modern Explanatory Dictionary, TSB:
(Prosopopoeia), eine Art Metapher, die die Eigenschaften belebter Objekte auf unbelebte überträgt („Ihre Amme ist die Stille ...“, A. A. ... - PERSONALISIERUNG in Uschakows Erklärendem Wörterbuch der russischen Sprache:
Personifikationen, vgl. (Buch). 1. Nur Einheiten Aktion gemäß Verb. personifizieren-personifizieren. Die Personifizierung der Naturgewalten bei Naturvölkern. 2. was. Die Verkörperung einiger. ... - PERSONALISIERUNG im Ephraims erklärenden Wörterbuch:
Personifikation vgl. 1) Der Handlungsprozess nach Bedeutung. Verb: personifizieren, personifizieren. 2) a) Die Verkörperung von jdm. Urgewalt, Naturphänomene in Form... - PERSONALISIERUNG im Neuen Wörterbuch der russischen Sprache von Efremova:
Heiraten 1. Handlungsablauf nach Kap. personifizieren, personifizieren 2. Die Verkörperung einer Elementarkraft, eines Naturphänomens im Bild eines Lebewesens. Ott. ... - PERSONALISIERUNG im Großen Modernen Erklärwörterbuch der russischen Sprache:
Heiraten 1. Handlungsablauf nach Kap. personifizieren, personifizieren 2. Das Ergebnis einer solchen Aktion; Verkörperung, konkreter, realer Ausdruck von etwas. Ott. Menschwerdung... - FEMINISMUS im Neuesten Philosophischen Wörterbuch.
- TRIMURTI im Dictionary Index of Theosophical Concepts to the Secret Doctrine, Theosophical Dictionary:
(Sanskrit.) Wörtlich „drei Gesichter“ oder „dreifache Form“ – Dreieinigkeit. Im modernen Pantheon sind diese drei Brahma, der Schöpfer; Vishnu, der Bewahrer; Und …
Wenn wir nur das Wort PERSONIFIKATION selbst betrachten, fällt natürlich die Wurzel GESICHT auf, was uns natürlich dazu drängt, dieses Konzept zu entschlüsseln.
Dieses Wort hat ein altes lateinisches Analogon „Personifizierung“, was übersetzt bedeutet: persona – Person, facio – ich tue. Und wieder stoßen wir hier auf das Wort „Gesicht“. Und das ist etwas, das den Lebewesen innewohnt.
Unter Personifizierung versteht man die Vermittlung und Übertragung von Eigenschaften, die ein lebendes Objekt besitzt, auf unbelebte Objekte und Phänomene. Unbelebte Objekte und Phänomene, die mit diesen Eigenschaften ausgestattet sind, erwerben beispielsweise die Fähigkeit zu lachen, traurig zu sein, nachzudenken, sich Sorgen zu machen usw.
Zum Beispiel könnten Wolken aufziehen, der Himmel könnte die Stirn runzeln und der Regen könnte anfangen zu weinen.
Die Welt durch Personifizierung verstehen

- Wenn wir uns der Antike zuwenden, wird klar, dass die Personifizierung ein wesentlicher Bestandteil der Kenntnis der Welt und der Naturphänomene war, als allen Phänomenen das Bild von Göttern gegeben und mit menschlichen Fähigkeiten ausgestattet wurde.
Die Techniken der Personifizierung im slawischen Heidentum sind deutlich sichtbar.

Personifikation in der Literatur
- In der Literatur wird die Personifizierung als künstlerisches Mittel zur Steigerung der Ausdruckskraft eingesetzt.
„Und, Brüder, Kiew stöhnte vor Trauer und Tschernigow vor Unglück. Melancholie hat sich im russischen Land ausgebreitet, große Traurigkeit breitet sich im russischen Land aus.“„Die Nacht kommt noch lange. Die Abenddämmerung hat ihr Licht verloren. So bedeckte die Dunkelheit das Feld. Schließlich schlief die kitzelnde Nachtigall ein; das Morgengeschwätz der Dohlen ist erwacht.“
Die ganze Natur ist mit Gefühlen ausgestattet, daher hört der Gesang der Nachtigall nicht nur auf, sondern schläft ein und die Morgendämmerung erhellt ihr Licht.
Personifizierung ist eine der Arten von Metaphern, aber dennoch handelt es sich um eine eigenständige Metapher, die nicht als Metapher bezeichnet werden sollte.
Der Vorläufer der Personifizierung ist der Animismus. In der Antike verliehen die Menschen den umgebenden Objekten und Phänomenen menschliche Eigenschaften. Beispielsweise wurde die Erde „Mutter“ genannt und der Regen mit Tränen verglichen. Im Laufe der Zeit ist der Wunsch, unbelebte Objekte zu vermenschlichen, verschwunden, aber in der Literatur und im Gespräch begegnen uns diese Redewendungen immer noch. Dieses bildliche Sprachmittel nennt man Personifikation.
PERSONIFIKATION ist ein literarisches Mittel, bei dem unbelebte Objekte mit Eigenschaften ausgestattet werden, die Lebewesen innewohnen. Manchmal wird diese Wendung Personifizierung genannt.
Personifizierung wird von vielen Prosaautoren und Dichtern verwendet. In Yesenin findet man zum Beispiel die folgenden Zeilen: „Der Winter singt, hallt wider, der zottelige Wald beruhigt sich.“ Es ist klar, dass der Winter als Jahreszeit keine Geräusche machen kann und der Wald nur durch den Wind Lärm macht.
Durch die Personifizierung können Sie beim Leser ein lebendiges Bild erzeugen, die Stimmung des Helden vermitteln und eine Aktion hervorheben.
Diese Wendung verwenden wir im Gegensatz zu einer komplexeren und raffinierteren Metapher, die eher für die Poesie geeignet ist, sogar in der Umgangssprache. Auch die bekannten Redewendungen „Die Milch ist weggelaufen“ und „Das Herz schlägt auf“ sind Personifikationen. Es macht unsere Alltagssprache ausdrucksvoller. Wir sind an viele Personifizierungen so gewöhnt, dass sie uns nicht überraschen. Zum Beispiel „es regnet“ (obwohl der Regen offensichtlich keine Beine hat) oder „die Wolken runzeln die Stirn“ (es ist klar, dass die Wolken keine Emotionen erleben können).
Im Allgemeinen können wir sagen, dass die Personifizierung ein Sprachtropus ist, bei dem das Unbelebte mit den Zeichen und Eigenschaften des Lebendigen ausgestattet wird. Personifizierung wird oft mit Metapher verwechselt. Aber eine Metapher ist nur eine bildliche Bedeutung eines Wortes, ein bildlicher Vergleich. Zum Beispiel: „Und du lachst mit einem wunderbaren Lachen, SCHLANGE IN EINER goldenen SCHÜSSEL.“ Hier gibt es keine Belebung der Natur. Daher ist es nicht schwer, Personifikationen von Metaphern zu unterscheiden.
Beispiele für Avatare:
Und wehe, wehe, wehe!
Und der Bast der Trauer war umgürtet,
FÜSSE SIND MIT WASTERN NACH OBEN GESTELLT.
(Volkslied)
DIE grauhaarige Zauberin kommt,
Shaggy WINKT MIT DEM ÄRMEL;
Und Schnee und Schaum und Frost FLIESSEN,
Und verwandelt Wasser in Eis.
Von ihrem kalten ATEM
Der Blick der Natur ist taub...
(G. Derzhavin)
Schließlich steht der Herbst schon vor der Tür
BLICKT durch die Spindel.
Der Winter folgt ihr
GEHT IN EINEM WARMEN PELZMANTEL,
Der Weg ist mit Schnee bedeckt,
Es knirscht unter dem Schlitten...
(M. Koltsov)
Beschreibung der Flut in Puschkins „Der eherne Reiter“:
„...Die Newa raste die ganze Nacht über / gegen den Sturm aufs Meer zu, / konnte ihre gewalttätige Torheit nicht überwinden ... / und es wurde ihr unmöglich, sich zu behaupten ... / Das Wetter wurde noch wilder, / Die Newa schwoll an und brüllte.../und plötzlich stürmte sie wie ein wildes Tier auf die Stadt zu.../Belagerung! Attacke! böse Wellen,/klettern wie Diebe durch die Fenster“ usw.
„Die goldene Wolke verbrachte die Nacht ...“ (M. Lermontov)
„Durch die azurblaue Dämmerung der Nacht
Die verschneiten Alpen BLICK
Ihre AUGEN sind tot
Zerschmettert vor eisigem Entsetzen“
(F. Tyutchev)
„Der warme Wind weht leise,
Die Steppe atmet mit frischem Leben“
(A. Fet)
"Weiße Birke
Unter meinem Fenster
MIT SCHNEE BEDECKT,
Genau Silber.
Auf flauschigen Zweigen
Schneegrenze
Die Pinsel sind aufgeblüht
Weißer Rand.
Und die Birke steht
In schläfriger Stille,
Und die Schneeflocken brennen
Im goldenen Feuer.
Und die Morgendämmerung, FAUL
HERUMLAUFEN
SPRAYS Filialen
Neues Silber.
(S. Yesenin „Birke“):
Unter den Personifikationen wahrer Poesie gibt es keine einfachen, spießbürgerlichen, primitiven Personifikationen, die wir im Alltag zu verwenden gewohnt sind.
Jede Personifikation ist ein Bild. Dies ist die Bedeutung der Verwendung von Personifizierung. Der Dichter verwendet es nicht als „Ding an sich“, sondern die Personifizierung erhebt sich über die „weltliche Ebene“ und bewegt sich auf die Ebene der Bildlichkeit. Mit Hilfe von Personifikationen schafft Yesenin ein besonderes Bild. Die Natur im Gedicht ist lebendig – aber nicht nur lebendig, sondern ausgestattet mit Charakter und Emotionen. Die Natur ist die Hauptfigur seines Gedichts.
Wie traurig sehen vor diesem Hintergrund die Versuche vieler Dichter aus, ein schönes Gedicht über die Natur zu schreiben, in dem „der Wind weht“, „der Mond scheint“, „die Sterne leuchten“ usw. für immer. Alle diese Personifikationen sind abgedroschen und abgenutzt, sie erzeugen keine Bilder und sind daher langweilig. Dies bedeutet jedoch nicht, dass sie nicht verwendet werden können. Und die ausgelöschte Personifikation kann auf die Ebene eines Bildes gehoben werden.
Zum Beispiel im Gedicht „It’s Snowing“ von Boris Pasternak:
Es schneit, es schneit.
Zu den weißen Sternen im Schneesturm
Geranienblüten strecken sich
Für den Fensterrahmen.
Es schneit und alles ist in Verwirrung,
Alles beginnt zu fliegen -
Schwarze Treppenstufen,
Kreuzung abbiegen.
Es schneit, es schneit,
Als ob es keine Flocken wären, die fallen,
Und in einem geflickten Mantel
Das Firmament fällt zu Boden.
Als würde er wie ein Exzentriker aussehen,
Von der obersten Landung aus,
Stehlen, Verstecken spielen,
Der Himmel kommt vom Dachboden herab.
Denn das Leben WARTET NICHT.
Bevor Sie zurückblicken: Es ist Weihnachtszeit.
Nur eine kurze Zeit,
Schauen Sie, da ist ein neues Jahr.
Der Schnee fällt, dick und dick.
Im Gleichschritt mit ihm, mit diesen Füßen,
Im gleichen Tempo, MIT FAULHEIT
Oder mit der gleichen Geschwindigkeit
Vielleicht vergeht die Zeit?
Vielleicht Jahr für Jahr
Folgen Sie, während der Schnee fällt
Oder wie die Worte in einem Gedicht?
Es schneit, es schneit,
Es schneit und alles ist in Aufruhr:
Weißer Fußgänger
ÜBERRASCHTE Pflanzen,
Kreuzungskurve.
Beachten Sie, wie viele Personifikationen es hier gibt. „Der Himmel kommt vom Dachboden“, Treppen und eine Kreuzung, die fliegen! Allein die „überraschten Pflanzen“ sind es wert! Und der Refrain (ständige Wiederholung) „es schneit“ bringt die einfache Personifizierung auf die Ebene der semantischen Wiederholung – und das ist bereits ein Symbol. Die Personifikation „Es schneit“ ist ein Symbol für das Vergehen der Zeit.
Daher sollten Sie in Ihren Gedichten versuchen, die PERSONIFIZIERUNG NICHT NUR FÜR SICH ZU VERWENDEN, SONDERN SO, DASS SIE EINE BESTIMMTE ROLLE SPIELT.
Personifikationen werden auch in der Belletristik verwendet. Ein hervorragendes Beispiel für die Personifizierung gibt es beispielsweise in Andrei Bitovs Roman „Puschkin-Haus“. Der Prolog beschreibt den Wind, der über St. Petersburg kreist, und die gesamte Stadt wird aus der Sicht dieses Windes gezeigt. Der Wind ist die Hauptfigur des Prologs. Nicht weniger bemerkenswert ist das Bild der Titelfigur von Nikolai Gogols Erzählung „Die Nase“. Die Nase wird nicht nur personifiziert und personifiziert (also mit menschlichen Persönlichkeitsmerkmalen ausgestattet), sondern wird auch zum Symbol der Dualität der Hauptfigur.
Ein paar weitere Beispiele für Personifizierung in der Prosarede, die mir in den Sinn kommen:
Die ersten Strahlen der Morgensonne stahlen sich über die Wiese.
Schnee verdunkelte den Boden wie das Baby einer Mutter.
Der Mond WINKTE durch die Höhen der Wolken.
Pünktlich um 6:30 Uhr klingelte mein Wecker.
Der Ozean TANZE im Mondlicht.
Ich hörte, wie die Insel mich rief.
Donner grummelte wie ein alter Mann.
Beispiele gibt es genug. Ich bin mir sicher, dass Sie bereit für die nächste Runde der „Trails“-Wettbewerbsreihe sind.
Herzlichst, Eure Alcora
Rezensionen
Allah, das sind die beiden Punkte des Artikels:
1. „PERSONIFIKATION ist ein literarisches Mittel, bei dem unbelebte Objekte mit Eigenschaften ausgestattet werden, die Lebewesen innewohnen. Manchmal wird diese Wendung Personifizierung genannt.“
2...Im Allgemeinen können wir sagen, dass die Personifizierung ein Ausdruck der Sprache ist, in dem das Unbelebte mit den Zeichen und Eigenschaften des Lebendigen ausgestattet wird...-
Hat dazu geführt, dass ich das Wesen der Personifizierung missverstanden habe. Hier geht es darum, unbelebten Objekten die Eigenschaften eines Lebewesens zu verleihen, d.h. Es stellt sich heraus, dass es sich sowohl um Tiere als auch um Pflanzen handelt und nicht nur um Menschen.
Ich glaube, ich bin nicht der Einzige. Es ist notwendig, die Dualität des Verstehens zu beseitigen.
Mit Dank für den Artikel, Vladimir.
In Teil 2 des Artikels über Personifikationen habe ich diese Frage bereits beantwortet (ich zitiere mich selbst):
„Kann man es als eine Personifizierung von „Schnurren“ oder „Wandern auf den Dächern“ betrachten? Wir vergleichen die Dunkelheit nicht mit einem Menschen, sondern mit einem Tier. Ich habe zu diesem Thema unterschiedliche Meinungen kennengelernt. Ich weiß nicht: „Ich würde daraus kein Problem machen – wie auch immer Sie es nennen, die Hauptsache ist, jede davon angemessen zu spüren und zu nutzen.“ um sie nutzen zu können, um Ihre Gedanken und Gefühle präzise und überzeugend zu vermitteln.“
Also noch einmal: Philologen haben viele (widersprüchliche) Meinungen, ich bin kein Philologe, ich bin ein Praktiker. Wenn ich an einem Wettbewerb teilnehmen würde, würde ich für die Runde diejenigen meiner Gedichte auswählen, die TYPISCHE Personifikationen haben (oder ich würde neue Gedichte für den Wettbewerb schreiben) und die vorgegebenen Wege hervorheben – als Werkzeuge für meinen Sieg im Wettbewerb. Das Gleiche gilt für die Juroren – sie müssen die Arbeit zunächst am Beispiel typischer (nicht zweifelhafter oder widersprüchlicher) gegebener Tropen betrachten, und alles andere ist eine Beilage.... Dies ist ein Bildungswettbewerb, bei dem Man muss sowohl Poesie als auch Beherrschung der Theorie beweisen und nicht nur zum Wettbewerb anbieten, was der Autor auf seinem Bauernhof hat und was einmal irgendwo erfolgreich war.
Wenn wir Poesie überhaupt bewerten, dann spielt es keine Rolle, wie dieser Trope heißt. Wichtig ist, dass er sich mit dem Thema befasst und ein Bild erzeugt, das verständlich und zutreffend ist.
Personifikation nennt man die Ausstattung unbelebter Gegenstände mit Zeichen und Eigenschaften einer Person: Stern spricht zu Stern. Die Erde schläft in blauem Glanz (L.); Die erste Morgenbrise ohne Rascheln... wehte die Straße entlang (Kap.). Wortkünstler machten die Personifizierung zum wichtigsten Mittel der bildlichen Sprache. Mit Personifikationen werden Naturphänomene beschrieben, Dinge, die eine Person umgeben und mit der Fähigkeit ausgestattet sind, zu fühlen, zu denken und zu handeln: Park schwankte und stöhnte (Paust.); Der Frühling wanderte mit leichtem Zugwind durch die Korridore und blies seinen mädchenhaften Atem ins Gesicht (Paust.); Donner murmelte schläfrig... (Paust.).In anderen Fällen werden die Objekte um uns herum „zum Leben erweckt“, wie in der von M. Bulgakov beschriebenen Szene.
Margarita schlug in die Klaviertasten und der erste heulende Ton hallte durch die ganze Wohnung. Beckers unschuldiges Kabinettinstrument schrie hektisch. Das Instrument heulte, summte, keuchte, klingelte ...
Margarita schwebte aus dem Fenster, fand sich außerhalb des Fensters wieder, schwang sich leicht und schlug mit einem Hammer auf das Glas. Das Fenster schluchzte, und Splitter liefen die mit Marmor ausgekleidete Wand hinunter.
Personifikation- einer der häufigsten Tropen nicht nur in der Belletristik. Es wird von Politikern verwendet (Russland wurde vom Schock von Gaidars Reformen geschlagen), die Personifizierung findet sich oft im wissenschaftlichen Stil (Röntgenaufnahmen zeigten, dass Luft heilt), im journalistischen Stil (Unsere Waffen haben gesprochen. Das übliche Duell von Batterien hat begonnen. - Ruhe. Die Technik der Personifizierung belebt die Schlagzeilen von Zeitungsartikeln: „Die Eisbahn wartet“, „Die Sonne beleuchtet die Leuchtfeuer“, „Das Spiel brachte Rekorde.“
Personifizierung erscheint in Form verschiedener Tropen, meistens sind dies Metaphern, zum Beispiel bei B. Pasternak: Trennung wird uns beide fressen, Melancholie wird uns mit Knochen verschlingen. Der Schnee verdorrt und wird krank vor Blutarmut, und man hört auf dem Flur, was unter freiem Himmel passiert, darüber spricht April in einem lockeren Gespräch mit einem Tropfen. Er kennt tausend Geschichten / Über menschliche Trauer... Die Zweige von Apfel- und Kirschbäumen sind in weißliche Farbe gekleidet. Manchmal wird die Personifizierung in Vergleichen, künstlerischen Definitionen erraten: Zu diesen Orten bahnt sich die Nacht als barfüßiger Wanderer ihren Weg entlang des Zauns, und dahinter erstreckt sich von der Fensterbank aus eine Spur eines belauschten Gesprächs (Vergangenheit); Im Frühling spielen diese kleinen Enkel mit dem rötlichen Sonnengroßvater. Wolken spielen... Aus kleinen zerrissenen, fröhlichen Wolken lacht die rote Sonne, Wie ein Mädchen aus Garben (N.); Der Osten (P.) war mit einer rötlichen Morgendämmerung bedeckt.
Interessant sind die detaillierten Personifikationen, dank derer der Autor ein ganzheitliches Bild schafft. Puschkin schrieb zum Beispiel: „Ich brachte eine verspielte Muse mit, zum Lärm von Festen und heftigen Auseinandersetzungen, zum Gewitter der Mitternachtswachen; Und zu ihnen bei verrückten Festen trug sie ihre Geschenke und tobte wie eine Bacchantin, sang für die Gäste beim Kelch, und die Jugend vergangener Tage trottete wild hinter ihr her. А в «Домике в Коломне» поэт даже шутя обращается к ней: — Усядься, муза: ручки в рукава, Подлавку ножки Не вертись, резвушка Теперь начнем... Полное уподобление неживого предмета человеку называется персонификацией (от лат. persona лицо, facto - machen). Um diese Art der Personifizierung zu veranschaulichen, präsentieren wir (in Abkürzung) den Anfang von Andrei Platonovs Märchen „Die unbekannte Blume“.
Es war einmal eine kleine Blume. Er wuchs allein auf einem unbebauten Grundstück auf. In Stein und Lehm gab es für ihn nichts zu essen; Regentropfen, die vom Himmel fielen, fielen auf die Erdoberfläche und drangen nicht bis zur Wurzel ein, aber die Blume lebte und lebte und wuchs nach und nach höher. Er hob die Blätter gegen den Wind; Staubkörner fielen vom Wind auf den Lehm; und in diesen Staubkörnern war Nahrung für die Blume. Um sie zu befeuchten, bewachte die Blume die ganze Nacht den Tau und sammelte ihn Tropfen für Tropfen ein ...
Tagsüber wurde die Blume vom Wind und nachts vom Tau bewacht. Er arbeitete Tag und Nacht, um zu leben und nicht zu sterben. Er brauchte das Leben und überwand seine Schmerzen durch Hunger und Müdigkeit mit Geduld. Nur einmal am Tag freute sich die Blume: als der erste Strahl der Morgensonne ihre müden Blätter berührte.
Wie wir sehen, wird die Personifizierung durch eine Reihe von Personifizierungen erreicht: Die Blume lebt, überwindet Hunger, Schmerz, Müdigkeit, braucht Leben und freut sich über die Sonne. Dank dieser Tropenkombination entsteht ein lebendiges künstlerisches Bild.
Im journalistischen Stil kann die Personifizierung einen hohen rhetorischen Klang erzielen. Also. während des Großen Vaterländischen Krieges A.N. Tolstoi schrieb in dem Artikel „Moskau wird von einem Feind bedroht“ an Russland:
Mein Mutterland. Du hattest eine schwierige Prüfung, aber du wirst siegreich daraus hervorgehen, denn du bist stark, du bist jung, du bist gütig, du trägst Güte und Schönheit in deinem Herzen. Sie alle hoffen auf eine glänzende Zukunft, Sie bauen sie mit Ihren großen Händen auf, Ihre besten Söhne sterben dafür.
Rhetorik hebt auch das Gegenteil der Personifizierung hervor – die Verdinglichung, bei der eine Person mit den Eigenschaften unbelebter Objekte ausgestattet wird. Zum Beispiel: die kugelsichere Stirn eines Banditen: Ein Sergeant der Verkehrspolizei mit einem Gesicht wie ein Fahrverbotsschild. Woher hast du diesen Idioten? Das ist ein Baumstumpf, ein Baumstamm! (Aus dem Gas.) - Unter den Verdinglichungen gibt es viele gängige sprachliche – Eiche, Säge, Matratze, Hut, Gesundheit ist gelöst.
Schriftsteller wissen, wie man mit Hilfe der Verdinglichung eine lebendige Ausdruckskraft der Sprache erreicht: Sein Herz klopfte und fiel für einen Moment irgendwohin, kehrte dann zurück, aber mit einer stumpfen Nadel darin (Bulg.); Der Kopf lässt die Blätter fallen und spürt den nahenden Herbst! Bald wird eine Fliege ungebremst auf Ihrem Kopf landen: Ihr Kopf ist wie ein Tablett, aber was wurde im Leben schon getan! (Aus einer Zeitschrift). Verdinglichung wird oft in einem humorvollen Kontext verwendet, was durch Beispiele aus den Briefen von A.P. bestätigt werden kann. Tschechow: Vaudeville-Geschichten strömen aus mir heraus wie Öl aus den Tiefen von Baku: Ich saß ständig zu Hause und ging Rosen sammeln... ohne zu wissen, wohin ich meine Füße lenken sollte, und den Pfeil meines Herzens mal nach Norden, mal nach Norden neigend im Süden, wenn plötzlich - scheiße. Ein Telegramm kam.
Verdinglichungen nehmen ebenso wie Personifikationen die Form von Metaphern und Gleichnissen an, wie aus den gegebenen Beispielen hervorgeht. Erinnern wir uns auch an die klassischen Verdinglichungen in Form von Vergleichen von B. Pasternak: ...Als ich vor allen anderen, mit dir, wie ein Trieb mit einem Baum, in meiner unermesslichen Melancholie zusammenwuchs... Sie war so Ihm lieb, jede Eigenschaft, da die Küsten nah am Meer liegen. Die gesamte Surflinie. Wie das Schilf überschwemmt. Eine Welle nach einem Sturm. Er sank bis auf den Grund seiner Seele. Seine Merkmale und Formen.
In der modernen Stilistik wird der von uns beschriebene Trope nicht hervorgehoben und Fälle seiner Verwendung werden als Teil von Metaphern und Vergleichen betrachtet. Die Rhetorik legt jedoch Wert auf die Verdinglichung als einen Tropus, der für die gesprochene Sprache der Sprecher relevant ist.
Schon in der Antike verliehen Menschen den umgebenden Objekten und Phänomenen menschliche Eigenschaften. Beispielsweise wurde die Erde „Mutter“ genannt und der Regen mit Tränen verglichen.
Im Laufe der Zeit ist der Wunsch, unbelebte Objekte zu vermenschlichen, verschwunden, aber in der Literatur und im Gespräch begegnen uns diese Redewendungen immer noch. Dieses bildliche Sprachmittel nennt man Personifikation. Was ist also Personifizierung?
Personifizierung: Definition und Funktionen
Personifizierung ist ein literarisches Mittel, bei dem unbelebte Objekte mit Eigenschaften ausgestattet werden, die Lebewesen innewohnen. Manchmal wird diese Wendung Personifizierung genannt.
Personifizierung wird von vielen Prosaautoren und Dichtern verwendet. In Yesenin findet man zum Beispiel die folgenden Zeilen: „Der Winter singt, hallt wider, der zottelige Wald beruhigt sich.“ Es ist klar, dass der Winter als Jahreszeit keine Geräusche machen kann und der Wald nur durch den Wind Lärm macht. Durch die Personifizierung können Sie beim Leser ein lebendiges Bild erzeugen, die Stimmung des Helden vermitteln und eine Aktion hervorheben.
Was Personifizierung in der Literatur ist, ist klar, aber diese Wendung wird auch in der Umgangssprache verwendet. Auch die bekannten Redewendungen „die Milch ist weggelaufen“, „das Herz schlägt auf“ sind Personifikationen. Die Verwendung dieses literarischen Mittels in einem Gespräch macht die Rede figurativ und interessant. Allerdings denken wir nicht einmal darüber nach, diese Technik einzusetzen.
Sie können auch Beispiele für Personifikationen nennen. Wir sagen zum Beispiel oft, dass es regnet (obwohl der Regen offensichtlich keine Beine hat) oder dass die Wolken die Stirn runzeln (es ist klar, dass Wolken keine Emotionen erfahren können).
Im Allgemeinen können wir sagen, dass die Personifizierung eine literarische Wendung ist, mit anderen Worten, ein Sprachtropus, in dem das Unbelebte mit den Zeichen und Eigenschaften des Lebendigen ausgestattet wird. Personifizierung wird oft mit Metapher verwechselt. Es lohnt sich zu verstehen, dass eine Metapher nur eine bildliche Bedeutung eines Wortes ist, ein bildlicher Vergleich. Zum Beispiel – „Goldener Herbst“. Daher ist es nicht schwer, die Personifizierung von anderen literarischen Ausdrucksformen zu unterscheiden.